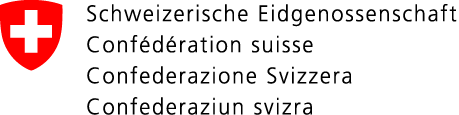3 Netzkosten (Kostenrechnung Kapitel 3)
3.1 Allgemeine Angaben (Kostenrechnung Kapitel 3.1)
3.1.1 Übersicht
Das Formular «Allgemeine Angaben» ist von allen Netzbetreibern auszufüllen und stellt die Grundlage für die Nachkalkulation des Tarifjahrs 2024 (vgl. Kapitel 3.2 der Kostenrechnung bzw. nachfolgend 3.2) dar. Bitte verwenden Sie für dieses Blatt ausschliesslich Ist-Werte und keine Planzahlen (Ist-Werte des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs).
Auf diesem Tabellenblatt sind die Kosten für das vorgelagerte Netz anzugeben. In der Vollversion sind zusätzlich die Kosten für Wirkverluste und Blindenergie aufzuführen.
3.1.2 Wirkverluste
Wirkverluste sind die Differenz zwischen der im Netz bereitgestellten und der an Endverbraucher und Nachlieger gelieferten elektrischen Energie (Transformierungs- und Übertragungsverluste). Sie sind in den Betriebskosten auszuweisen (vgl. 3.2.9 ff.). Die Wirkverluste müssen pro Netzebene ermittelt werden. Die Wirkverluste pro Netzebene werden, wo immer möglich, mittels Differenzmessung bestimmt. Sind bei einzelnen Netzebenen keine Messungen bzw. eine ungenügende Anzahl Messstellen vorhanden, werden die Verluste via Gesamtenergiebilanz mittels Verteilschlüssel oder Modellrechnung auf die Netzebenen verteilt (siehe auch VSE Dokument DC – CH, Ausgabe 2020, Ziffer 8.3).
Die Wirkverluste werden pro Netzebene in Prozent angegeben und sind gemäss folgender Formel zu berechnen (siehe auch VSE Dokument DC – CH, Ausgabe 2020, Ziffer 8.3.1):

Es ist zu beachten, dass die Ist-Kosten der Wirkverluste auf tatsächlichen Kosten beruhen müssen, die allenfalls geschlüsselt werden. Ein Ausweis der Kosten für Wirkverluste für die Berechnung der Deckungsdifferenzen auf Basis von Plan- oder Schätzwerten ist nicht zulässig.
3.1.3 Blindenergie
Der Netzbetreiber stellt den Blindleistungsausgleich in seinem Verteilnetz sicher. Die notwendigen Möglichkeiten der Kompensation im Verteilnetz und in den angeschlossenen Erzeugungseinheiten hält der Netzbetreiber selbst bzw. über Verträge durch Dritte im erforderlichen Umfang vor. Vergleiche dazu das VSE Branchendokument Distribution Code Schweiz (DC-CH).
Beim Blindenergieausgleich ist eine verursachergerechte Direktverrechnung, z.B. bei einem cos(φ) < 0.90, möglich. Wird von der Möglichkeit zur Direktverrechnung Gebrauch gemacht, muss sichergestellt werden, dass es zu keiner doppelten Verrechnung im Netznutzungsentgelt und der Direktverrechnung kommt.
3.1.4 Vermeidung von sog. Pancaking Situationen
Wenn Netze unterschiedlicher Eigentümer innerhalb einer Netzebene hintereinandergeschaltet oder auf der gleichen Netzebene vermischt sind, entsteht eine sog. «Pancaking-Situation», d. h die Gefahr, dass Endverbraucher mehrfach mit den Kosten einer Netzebene belastet werden: Die Kosten der Netzebene des einen, nachgelagerten Netzbetreibers summieren sich zu den in Rechnung gestellten Netzkosten des Vorliegers. Diese – höheren – Kosten darf der Nachlieger seinerseits wieder weiterreichen.
Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) hat in seinem Branchendokument «Netznutzungsmodell für das Schweizerische Verteilnetz» (NNMV-CH) Regeln im Sinne von Artikel 17 StromVV für solche Themen festgelegt. Die ElCom hat sich ebenfalls bereits zu diesem Thema geäussert (vgl. dazu Verfügung der ElCom 921-10-007 vom 20. Oktober 2011).
Die ElCom beobachtet solche Konstellation kritisch: Die Netzbetreiber sind verpflichtet, durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass keine Mehrfachbelastung der Endverbraucher resultiert, die sich allein dadurch ergibt, dass mehrere Akteure auf der gleichen Netzebene für den Netzbetrieb zuständig sind.
3.2 Berechnung Deckungsdifferenzen Netz (Kostenrechnung, Kapitel 3.2)
3.2.1 Rechtsgrundlagen
Nach der Einführung von Art. 18a StromVV, der am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, hat die ElCom die neue Weisung 3/2024 vom 4. März 2024 und 4. Februar 2025 zu den Deckungsdifferenzen (DD) in den Bereichen Netz und Energie aus früheren Jahren veröffentlicht. Die neuen Bestimmungen zu den DD gelten erstmals für die DD des auf das Inkrafttreten folgenden Geschäftsjahrs (Art. 31m StromVV). Art. 18a StromVV findet somit erstmals Anwendung auf die DD des Geschäftsjahrs 2023/2024 (Wasserwirtschaftsjahr) beziehungsweise 2024 (Kalenderjahr). Art. 18a wird am 1. Januar 2026 zu Art. 18b.
Stimmt die Summe des Netznutzungsentgelts, das der Netzbetreiber während eines Tarifjahrs erhoben hat, nicht mit den anrechenbaren Netzkosten überein (Deckungsdifferenz), so muss er die Abweichung innert der nächsten drei Tarifjahre ausgleichen. Bei einer Unterdeckung kann er auf den Ausgleich verzichten (18a Abs. 1 StromVV).
In begründeten Fällen kann die ElCom den Zeitraum zum Ausgleich einer Deckungsdifferenz verlängern (Art. 18a Abs. 2 StromVV).
Für die Deckungsdifferenzen ab dem Geschäftsjahr 2024 ist die Weisung 3/2024 (inkl. Erhebungsbogen Deckungsdifferenzen) zu beachten. Für den Umgang mit den Deckungsdifferenzen bis und mit Ende Geschäftsjahr 2023 kommt die Weisung 2/2019 (inkl. Formular Deckungsdifferenzen) weiterhin zur Anwendung.
Für weitere Informationen bezüglich der Deckungsdifferenzen vgl. Verfügung Tarife NE 1 2012 vom 12. März 2012 bzw. die Verfügungen zu den Deckungsdifferenzen der Netzebene 1 der Jahre 2011 und 2012 vom 12. Januar 2021 bzw. vom 9. Februar 2021 (abrufbar unter Verfügungen > Jahr 2012 bzw. Jahr 2021).
3.2.2 Allgemeines zum Formular
Das Formular «Berechnung Deckungsdifferenzen Netz» ist von allen Netzbetreibern auszufüllen.
Deckungsdifferenzen entstehen aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Tarifkalkulation, Tarifeinnahmen und den effektiven Kosten eines Geschäftsjahrs. Im Rahmen der Berücksichtigung der Deckungsdifferenzen aus den Vorjahren werden Differenzen zwischen den anrechenbaren Kosten und den realisierten Erlösen einer Kalkulationsperiode ausgeglichen.
Dabei werden insbesondere Differenzen berücksichtigt,
1. die sich aus Abweichungen zwischen dem prognostizierten und dem tatsächlichen Mengengerüst ergeben,
2. die sich aus Abweichungen zwischen Plankosten und tatsächlichen Kosten ergeben,
3. die im Rahmen einer Prüfung durch die ElCom festgestellt werden oder
4. die daraus resultieren, dass kostenwirksame Sondereffekte nicht in voller Höhe in einer Kalkulationsperiode erfasst werden sollen, um so die Tarife zu glätten.
Die Formulare für die Erhebung der Kosten als Basis für die Berechnung der Deckungsdifferenzen des Basisjahrs 2024 (Kapitel 3.2 der Kostenrechnung) und für den Nachweis der Kosten als Basis für die Tarifierung des Tarifjahrs 2026 (Kapitel 3.3 der Kostenrechnung) sind gleich aufgebaut. Die Nummern der Kostenpositionen folgen jenen des Schemas Kostenrechnung des VSE (KRSV-CH).
Im Formular 3.2 Deckungsdifferenzen Netz (weitere) werden die Über- oder Unterdeckungen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs berechnet. Zur Berechnung der Deckungsdifferenzen des eigenen und des vorgelagerten Netzes (inkl. SDL sowie Stromreserve) aus dem Vorjahr ist die Kostenrechnung Formular 3.2 Deckungsdifferenzen Netz auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten (inkl. kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen) und der sonstigen Erlöse des Vorjahrs (Ist-Kosten und Ist-Erlöse) auszufüllen. Dies gilt auch für die Energieflüsse und Leistungswerte, welche bei der Wälzung als Basis für die Berechnung der Deckungsdifferenzen pro Netzebene verwendet werden. Im Formular 3.2 Deckungsdifferenz Netz (weitere) wird die Deckungsdifferenz automatisch berechnet. In der Position 2 zu deklarieren sind allfällige aufgrund einer Verfügung der ElCom oder eines Gerichtsurteils anzupassende Werte vergangener Tarifjahre sind. In Position 3 sind Über- bzw. Unterdeckungen aus Vorjahren zu deklarieren, die weder Position 1 noch Position 2 zuzuordnen sind (vgl. Ziff. 3.2.25).
3.2.3 Zeitpunkt der Berechnung von Deckungsdifferenzen
Die Berechnung der Deckungsdifferenz ist für jedes Geschäftsjahr durchzuführen. Im Rahmen der Erhebung für die Tarife 2026 werden somit die Deckungsdifferenzen für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr (2024) berechnet.
Für die Berechnung der Deckungsdifferenzen werden die effektiven Erlöse des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs (2024) mit den tatsächlichen Kosten des Geschäftsjahrs 2024 verglichen.
Folgende Abbildung veranschaulicht die Zusammenhänge bezüglich der Tarifjahre (TJ) und der Geschäftsjahre (GJ) sowie der Berechnung der Deckungsdifferenzen (DD):

Jeweils am Ende eines abgelaufenen Geschäftsjahrs (im Beispiel GJ 0) werden die Deckungsdifferenzen Netz des abzuschliessenden Geschäftsjahrs berechnet (=Nachkalkulation TJ 0). Allfällige Deckungsdifferenzen aufgrund von Verfügungen der ElCom oder Gerichtsurteilen sowie sonstige Deckungsdifferenzen sind zu berücksichtigen. Diese Deckungsdifferenzen sind i.d.R. über drei Jahre verteilt in die Tarife der folgenden Jahre einzurechnen (im Beispiel Tarifkalkulation TJ 2, TJ 3 und TJ 4).
Am Ende des nächsten Geschäftsjahrs (GJ 1) wird wiederum die Deckungsdifferenz des abgelaufenen Tarifjahrs berechnet (= DD aus TJ 1). Sind noch Differenzen aufgrund von Verfügungen der ElCom oder Gerichtsurteilen entstanden, sind diese ebenfalls zu berücksichtigen. Der erste abzubauende Teil dieser Deckungsdifferenz wird in der Tarifkalkulation für das Tarifjahr TJ 3 berücksichtigt.
3.2.4 Berechnung der Deckungsdifferenzen pro Netzebene
Die Deckungsdifferenzen Netz sind pro Netzebene zu rechnen und auszuweisen.
Oft können die Kosten des Netzbetriebes nicht einer einzigen Netzebene zugeordnet werden. Für diesen Fall sieht der VSE (vgl. KRSV-CH) zwei Lösungsvarianten vor:
- Die nicht direkt auf eine Netzebene zuteilbaren Kosten des Netzbetriebes werden der höchsten betroffenen Netzebene des Verteilnetzbetreibers zugeordnet. Über die Wälzung werden dann die einzelnen Netzebenen mit Netzabsatz aufgrund des Wälzmodells belastet.
- Die Kosten des Netzbetriebes werden mittels Verteilschlüssel auf die einzelnen Netzebenen aufgeteilt.
3.2.5 Verzinsung der Deckungsdifferenzen
Gemäss der Weisungen 3/2024 und 2/2019 der ElCom (inkl. Anhänge) der ElCom ist das massgebliche Referenzjahr für den anwendbaren WACC nicht das Tarifjahr, in dem die Deckungsdifferenz entstanden ist (t), sondern jenes Jahr, in dem diese frühestens in die Tarife eingerechnet werden kann (t+2). Diese Verzinsungsmethodik wurde vom Bundesgericht bestätigt (Urteil des Bundesgerichts 2C_1076/2014 vom 4. Juni 2015 E. 4).
Der Deckungsdifferenzsaldo per Ende Geschäftsjahr 2023 ist mit dem jeweiligen WACC Netz t+2 zu verzinsen[1]. Er ist somit spätestens bis Ende Geschäftsjahr 2027 vollständig (d. h. inkl. Zins) abzubauen.
Für die DD Netz bis 2023 wird die Vergütung auf Grundlage des WACC Netz im laufenden Tarifjahr (t+2) berechnet. Ab der DD 2024 (t) wird die Vergütung hingegen auf Grundlage des Fremdkapitalverzinsungssatzes des laufenden Tarifjahrs (t+2) berechnet (Art. 18a Abs. 3 StromVV).
Somit müssen die Überdeckungen im Netz mindestens zum Satz des Jahrs der aktuellen Tarifberechnung vergütet werden. Liegt bis 2023 ein positiver Saldo der Deckungsdifferenzen vor, muss dieser mindestens zum WACC Netz für das Tarifjahr 2026, also mit 3,43 %, verzinst werden. Bei einer Überdeckung im Jahr 2024 hingegen ist diese zum Fremdkapitalverzinsungssatz des Tarifjahrs 2026, also mit 2,00 %, zu verzinsen (Art. 18a Abs. 3 Bst. b StromVV).
Der für Unterdeckungen beim Netz geltende Zinssatz beträgt höchstens den Zinssatz des Tarifjahrs, in dem die Tarife berechnet werden. Liegt bis 2023 ein negativer Saldo der Deckungsdifferenzen vor, darf dieser höchstens mit dem für das Tarifjahr 2026 geltenden WACC Netz, also mit 3,43 %, verzinst werden. Bei einer Unterdeckung im Jahr 2024 hingegen ist diese zum Fremdkapitalverzinsungssatz des Tarifjahrs 2026, also zu 2,00 %, zu verzinsen. Für Unterdeckungen können Sie jederzeit einen niedrigeren Zinssatz anwenden oder ganz auf eine Verzinsung verzichten (Art. 18 Abs. 3 Bst. a StromVV).
[1] Das Jahr «t» bezeichnet dasjenige Geschäftsjahr, für welches die Deckungsdifferenzen berechnet werden.
3.2.6 Abbau von Deckungsdifferenzen
Ein effizienter (Art. 14 Abs. 3 Bst. a und Art. 15 Abs. 1 StromVG) Abbau der Deckungsdifferenzen liegt vor, wenn dadurch unnötige, von den Endverbrauchern zu tragende (Zins-)Kosten vermieden werden und der Abbau zeitnah erfolgt. Der auszugleichende Deckungsdifferenzbetrag muss inklusive der jeweiligen Verzinsung spätestens innert der nächsten drei Tarifjahre vollständig abgebaut sein (Art. 18a Abs. 1 StromVV).
Der Abbau einer Deckungsdifferenz über mehr als drei Jahre ist nur mit Genehmigung der ElCom zu-lässig (Art. 18a Abs. 2 StromVV). Möchte ein Netzbetreiber eine Deckungsdifferenz über einen längeren Zeitraum abbauen, hat er dazu ein begründetes Gesuch bei der ElCom einzureichen (Art. 18a Abs. 2 StromVV).
Unterdeckungen, welche nach drei Jahren oder nach Ablauf der verlängerten Abbaudauer nicht abgebaut sind, sind tarifneutral auszubuchen.
Es gibt insbesondere folgende Arten, eine realisierte Deckungsdifferenz des Geschäftsjahrs t auszugleichen:
- Eintarifierung ab Jahr t+2: Der im Rahmen der Tarifierung für den Abbau eingeplante Betrag ist verbindlich und bei der Nachkalkulation identisch zu übernehmen.
- Tarifneutrales Ausbuchen: Nur Unterdeckungen dürfen tarifneutral ausgebucht werden. Überdeckungen sind zwingend auszugleichen.
Ein laufendes Verfahren bei der ElCom oder vor Gericht, welches Auswirkungen auf Deckungsdifferenzen haben kann, stellt keinen Grund dar, auf den weisungskonformen Abbau der deklarierten Deckungsdifferenzen zu verzichten oder Zinsen auflaufen zu lassen.
Für die DD Netz bis 2023 gilt weiterhin die Regel zum Verrechnen des Saldos. Der Deckungsdifferenzsaldo per Ende Geschäftsjahr 2023 muss über längstens drei Jahre abgebaut werden. Er ist somit spätestens bis Ende Geschäftsjahr 2027 vollständig (d. h. inkl. Zins) abzubauen. Vorbehalten bleibt eine Genehmigung der ElCom für einen längeren Abbau. Ab 2024 werden die Deckungsdifferenzen der einzelnen Geschäftsjahre nicht mehr saldiert (Art. 18a StromVV).
Im Formular 3.2 Deckungsdifferenz Netz (weitere) ist der Abbau des Deckungsdifferenzsaldos 2023 und der Deckungsdifferenz 2024 je separat, d. h. unsaldiert auszuweisen.
3.2.7 Unterdeckungen
Deckungsdifferenzen dürfen nicht als Finanzierungsinstrument oder zur Äufnung von Reserven verwendet werden. Eine Reservehaltung insbesondere von Unterdeckungen ist daher nicht zulässig.
Die ElCom beobachtet genau, ob Netzbetreiber allenfalls bereits im Rahmen der Tarifierung mit Unterdeckungen rechnen, d. h. Unterdeckungen bereits bei der Kalkulation in Kauf genommen werden. Die gezielte Bildung von Deckungsdifferenzen, insbesondere von Unterdeckungen bereits bei der Kalkulation, ist aus Sicht der ElCom nicht rechtens. Die Netzbetreiber sind angehalten, die Kalkulation der Kosten und der darauf basierenden Tarife sorgfältig und mit dem Ziel einer ausgeglichenen Kosten-Erlösbilanz am Ende des Tarifjahrs vorzunehmen.
Entstehen Unterdeckungen durch (politische) Entscheide, nicht alle Kosten in die Tarife einzurechnen und sollen diese Unterdeckungen bewusst nicht tarifwirksam abgebaut werden, so dürfen die Deckungsdifferenzen nicht angehäuft werden. Der entsprechende Betrag ist tarifneutral aus den Unterdeckungen zu eliminieren. Dies kann über eine «Ausbuchung» erfolgen (Eintrag als Positivwert in der Rubrik «übrigen Deckungsdifferenzen»).
3.2.8 Ausweis der Kapitalkosten (Position 100)
3.2.8.1 Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Grundsätze
Gemäss Artikel 15 Absatz 3 StromVG werden die anrechenbaren Kapitalkosten auf Basis der ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten (AHK) ermittelt. Dabei ist die Höhe des anrechenbaren regulatorischen Anlagevermögens und damit die Bewertung zentral (vgl. oben, 2.2 ff. sowie 2.3 ff.). Massgeblich sind einerseits die Abschreibungen auf den kalkulatorischen Anlagerestwerten sowie andererseits die kalkulatorischen Zinsen auf den für den Betrieb des Netzes notwendigen Vermögenswerten.
3.2.8.2 Ausweis der kalkulatorischen Abschreibungen (Pos. 100.1)
Zu den Abschreibungen vgl. oben, 2.2.15.
3.2.8.3 Ausweis der kalkulatorischen Zinsen der Netze (Position 100.2)
Netzbetreiber haben Anrecht auf kalkulatorische Zinsen auf den für den Betrieb des Netzes notwendigen Vermögenswerten. Der massgebliche kalkulatorische Zinssatz entspricht dem Satz der durchschnittlichen Kosten des eingesetzten Kapitals (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Der WACC beschreibt, welche Rendite die Kapitalgeber im Durchschnitt auf ihr eingesetztes Kapital unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos erwarten können (vgl. ANDRE SPIELMANN in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [Hrsg.], Band I, Bern 2016, Art. 15 StromVG, Rz. 58). Der WACC für das Netz wird jährlich durch das UVEK aufgrund von Berechnungen des BFE und nach Konsultation der ElCom festgelegt.
Als Netzbetreiber können Sie einen tieferen als den für das betroffene Tarifjahr gültigen WACC für die Verzinsung Ihres betriebsnotwendigen Vermögens einsetzen. Dies kann dann der Fall sein, wenn explizit auf den maximal zulässigen regulatorischen Gewinn verzichtet wird. Der gesetzlich festgelegte gültige WACC darf hingegen nie überschritten werden.
Zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen gelten die oben beschriebenen Grundsätze (vgl. 3.2.5).
3.2.8.4 Ausweis der kalkulatorischen Zinsen für Anlagen im Bau (Position 100.3)
Die Ausführungen oben im Absatz 3.2.8.3 Ausweis der kalkulatorischen Zinsen der Netze (Position 100.2) sowie jene oben in Absatz 2.2.6 Anlagen im Bau sind hier zu beachten.
3.2.9 Ausweis der Betriebskosten (Position 200)
3.2.9.1 Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Grundsätze
Als Betriebskosten gelten die Kosten für die mit dem Betrieb der Netze direkt zusammenhängenden Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Kosten für Systemdienstleistungen sowie für den Unterhalt der Netze (aArt. 15 Abs. 2 StromVG). Zusätzlich gelten auch Entgelte für die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb als anrechenbare Betriebskosten (Art. 15 Abs. 2 Bst. c StromVG).
Betriebskosten sind nur anrechenbar, soweit sie für den sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb notwendig sind (Art. 15 Abs. 1 StromVG). Zur Überprüfung, ob es sich bei den geltend gemachten Kosten um «Kosten eines effizienten Netzes» handelt, kann die ElCom Effizienzvergleiche durchführen (Art. 19 Abs. 1 StromVV).
Die Betriebskosten basieren auf den Ist-Werten der Kosten gemäss Ihrer Jahresrechnung bzw. der Finanzbuchhaltung (vgl. auch oben 1.1.6.2 oben).
Bei der Bestimmung der Betriebskosten stehen immer zwei Fragen im Mittelpunkt:
- Sind alle Betriebskosten auch tatsächlich regulatorisch anrechenbar?
- Sind alle Betriebskosten auch korrekt dem Netz oder der Energie zugeordnet?
Grob können Netzbetreiber in zwei Gruppen eingeteilt werden: «reine Elektrizitätsversorger» und «Querverbundsunternehmen», welche noch andere Aktivitäten betreiben. Insbesondere bei Letzteren stellt sich immer auch das Problem der korrekten Kostenzuordnung zwischen den verschiedenen Bereichen. Erfolgt diese Zuordnung nicht korrekt, führt dies zu gewollten oder ungewollten, aber jedenfalls nicht erlaubten Quersubventionierungen zwischen dem Netzbetrieb und den übrigen Tätigkeitsbereichen (zum Beispiel Energie oder Kommunikation).
3.2.9.2 Kostenzuweisung und Schlüsselung
Bei der Zuweisung von Betriebskosten gelten folgende Grundsätze: Kosten werden wo immer möglich direkt zugewiesen. Wenn dies nicht möglich ist, dürfen sie geschlüsselt werden. Kosten sind gemäss Artikel 7 Absatz 5 StromVV verursachergerecht allen Bereichen, welche die Kosten verursachen, zuzuordnen. Dazu müssen die Schlüssel sachgerecht, nachvollziehbar, stetig verwendet und dokumentiert sein.
Sachgerecht ist ein Schlüssel, wenn er zu einer verursachergerechten Kostenaufteilung führt und andere in Betracht kommende Schlüssel keine bessere, d. h. verursachergerechtere Lösung bieten.
So ist eine Schlüsselung der Personalkosten im Verhältnis zum Personalbestand der verschiedenen Geschäftsbereiche sachgerecht. Gleiches gilt auch für die Schlüsselung von Informatikkosten anhand der Anzahl IT-Arbeitsplätze der verschiedenen Geschäftsbereiche. Auch eine aufwandmässige Verteilung der Kosten, d. h. ein Schlüssel auf der Basis von anteilig geleisteten und rapportierten Stunden wäre sachgerecht.
Hingegen ist eine Schlüsselung nach dem Umsatz oder auf Basis der Gesamtkosten nicht sachgerecht. Im regulatorischen Bereich leitet sich der Umsatz aus den regulatorischen Kosten ab – der Schlüssel würde sich also auf sich selbst beziehen. Er bildet die Verursacher der Kosten nicht ab, sondern nur das gesamte Unternehmen als Verursacher.
Nachvollziehbar ist ein Schlüssel dann, wenn sachkundige Dritte ohne Hinzuziehen weiterer Informationen erkennen können, wie und auf welcher Datengrundlage die Schlüssel gebildet wurden. Zur Nachvollziehbarkeit gehört auch der Nachweis der Kosten bzw. der dem Schlüssel zugrundeliegenden Werte. Hier können zum Beispiel die rapportierten Stunden oder rapportierte gefahrene Kilometer von Fahrzeugen genannt werden.
So kann ein Schlüssel vielleicht sachgerecht sein, aber nicht nachvollziehbar, weil die zugrundeliegenden Werte nicht nachgewiesen sind. Dies wäre der Fall bei einer Kostenschlüsselung auf Basis von geschätztem Aufwand, wenn keine Stundenrapportierung vorliegt.
Die Definition der Schlüssel muss schriftlich vorliegen und beispielsweise in einem Kostenrechnungs-Handbuch oder ähnlichem festgehalten sein.
Aus dem Grundsatz der Stetigkeit folgt, dass Schlüssel geeignet sein müssen, um über viele Geschäftsjahre hinweg eine verursachungsgerechte Schlüsselung zu ermöglichen.
Die ElCom hat sich in verschiedenen Verfügungen zu Schlüsselungen geäussert (vgl. Verfügung 211-00016 der ElCom vom 17. November 2016 oder Abschlussschreiben 212-00233 der ElCom vom 21. November 2017).
3.2.9.3 Interne Verrechnungen
Interne Verrechnungspreise müssen streng kostenbasiert sein und dürfen keine Anteile enthalten, welche bereits über die regulierten Kapital- und Betriebskosten abgegolten sind.
Dazu gehört jegliche Art von Gewinnanteilen, die dem Netz verrechnet werden oder Kosten, die zu einer Doppelverrechnung führen würden wie zum Beispiel:
- Abschreibungsanteile von auch im regulatorischen Anlagevermögen enthaltenen und damit bereits dort abgeschriebenen Anlagen
- Gewinnanteile bei Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens
- Gewinnzuschläge für den Verkauf von Energie vom Vertrieb ans Netz
- Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen, diese sind über den WACC gedeckt
Regulierte Bereiche dürfen bei der Leistungsverrechnung nicht benachteiligt werden. Dies bedeutet, dass die Leistungen, welche vom Netz für andere Sparten erbracht werden, angemessen zu entschädigen sind. Umgekehrt müssen Leistungen, welche von anderen Sparten fürs Netz erbracht werden, werthaltig sein und auf kostenbasierten Preisen beruhen. Dies bedeutet, die Leistungen fürs Netz müssen in einer vernünftigen Zeit erbracht werden und zu den vereinbarten Resultaten führen. Die Kosten des Netzes sind darüber hinaus um die erbrachten und verrechneten Leistungen zu entlasten (Ausweis in der Position «sonstige Erlöse», vgl. Absatz 3.2.21.2 unten). Die Grundlagen interner Verrechnung von Leistungen mit Ressourcen des Netzes an andere Sparten und an Dritte müssen dokumentiert und nachvollziehbar sein. Die Verrechnung von Leistungen von anderen Sparten in das Netz sind ebenfalls zu dokumentieren. Dazu gehören u. a. die verrechneten Preise, die Ziele der Leistungserbringung und die entsprechenden Abrechnungen und Rapporte.
Die Grundsätze interner Verrechnungen sind stetig anzuwenden. Verrechnungspreise und die darunterliegenden Kostenkomponenten und die Methodik sind zu dokumentieren – beispielsweise in einem Accounting Manual oder in ähnlichen Unterlagen.
Weiter beobachtet die ElCom aussergewöhnliche Unternehmensstrukturen kritisch: Solche Strukturen dürfen nicht der Umgehung von StromVG-relevanten Regeln für die Netznutzungsentgelte dienen.
3.2.9.4 Nutzung von (Reserve-) Infrastruktur durch Dritte
Unter dem Begriff «Dritte» sind hier alle netzfremden Bereiche oder externe Dritte gleichermassen subsummiert. Die Verwendung von Infrastruktur aus dem Monopolbereich darf Dritten nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Dies auch nicht unter dem Argument die «Infrastruktur sei ja bereits da» bzw. das für den Betrieb «nötige Personal sei ja bereits entlohnt». Wird Infrastruktur aus dem Monopol mit oder ohne weitere Ressourcen von anderen Bereichen benutzt, ist dies zu Marktverhältnissen («at arm’s length») zu entschädigen und die Netzkosten sind um diese Entschädigung zu entlasten (Ausweis in der Position «sonstige Erlöse», vgl. Absatz 3.2.21.1 unten).
Nachfolgend ein Beispiel aus der Praxis:
Bei der Erstellung von Stromtrassen werden häufig Reserverohre verlegt, um spätere Netzerweiterungen und Netzverstärkungen ohne grossen Aufwand zu ermöglichen. Die Mehrkosten die durch zusätzliche Reserverohre verursacht werden, sind praktisch vernachlässigbar. Um Duplizierungen von Kabelkanalisationen zu verhindern, werden nicht benötigte Reserverohre oder nur zu einem geringen Teil belegte Rohre für Glasfaserkabel verwendet. Diese Benutzung ist dem «Netz» zu entschädigen. Verschiedentlich wird diesbezüglich argumentiert, dass der Platz für die Belegung mit Glasfaserkabeln kostenlos sei. Ausserdem werden mancherorts die Glasfaserkabel nebst der Verwendung ausserhalb des Strombereichs (Datenkommunikation, Internet etc.) auch für die Kommunikation mit Smart Metern verwendet. Entsprechend hatten einzelne Netzbetreiber die gesamte Glasfaserinfrastruktur fälschlicherweise den Netzkosten angelastet.
Da die Kapazitäten von Glasfasern die bei Smart Metering-Lösungen zu übertragenden Datenmengen bei Weitem übersteigen und für die Übertragung relativ kleiner Datenmengen der Aufbau eines wie in manchen Fällen flächendeckenden (eine Faser zu jedem Gebäude) Glasfasernetzes nicht notwendig erscheint, sind die Kosten eines Glasfasernetzes nur begrenzt dem Bereich «Netz» anlastbar.
Ausschlaggebend für die Kostenteilung von Glasfaserkabeln, die in Stromtrassen verlegt werden, ist Artikel 10 Absatz 1 StromVG. Dieser besagt, dass Quersubventionierungen zwischen dem Netzbetrieb und den übrigen Tätigkeitsbereichen untersagt sind. Glasfasernetzdienstleistungen sollen nicht auf Kosten der Stromversorgung günstiger angeboten werden können. Zur Umsetzung einer verursachergerechten Kostenzuordnung müssen gemäss Artikel 7 Absatz 5 StromVV sachgerechte Schlüssel definiert und angewendet werden. Die vom VSE vorgeschlagene Aufteilung bzw. Schlüsselung der Kosten nach dem Querschnitt in Trassen erachtet die ElCom beispielsweise als sachgerecht (vgl. Mitteilung der ElCom vom 8. Juli 2011 sowie vom 4. Oktober 2010, abrufbar unter Mitteilungen).
3.2.9.5 Marketing und Werbung sowie Sponsoring
Marketing- und Sponsoringkosten sind für den sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb nicht notwendig (Art. 15 Abs. 1 StromVG). Kosten, welche mit Sponsoring von Sport-, Kultur- oder anderen Veranstaltungen zusammenhängen, werden daher nicht als Betriebskosten akzeptiert. Entsprechendes gilt für die Kosten, die mit der Werbung für die Kundenakquisition und Produkteinführungen zusammenhängen oder auch in Bezug auf unternehmerische Massnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien.
3.2.9.6 Zinsaufwände für Fremdkapital
Zinsaufwände für Fremdkapital bilden keinen Bestandteil der Betriebskosten. Für die Berechnung der anrechenbaren Kapitalkosten werden die kalkulatorischen Anlagerestwerte mit dem WACC verzinst. Im WACC sind zugunsten der Netzeigentümer bereits Fremdkapitalzinsen enthalten, ohne dass dabei berücksichtigt würde, ob diese effektiv als Aufwand anfallen (ANDRE SPIELMANN in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [Hrsg.], Band I, Bern 2016, Art. 15 StromVG, Rz. 71).
3.2.9.7 Betriebs- und Kapitalkosten des Messwesens
Es ist zu beachten, dass die kalkulatorischen Kosten von Steuer- und Regelsysteme (auch genannt «Fern- und Rundsteuerung») für die Tarifberechnung in den Positionen 530 auszuweisen sind (vgl. Art. 7 Abs. 3 Bst. m StromVV). Diese dürfen folglich nicht mehr in der Position 200 erfasst werden. Sollten wälzbare Kosten, gleich welcher Art, ausnahmsweise keiner Position zugeordnet werden können, sind diese unter Position 200.3 auszuweisen.
Kosten aus einer risikobasierten und effizienten Umsetzung von Massnahmen zur Cybersicherheit sind anrechenbar. Dazu bietet der Leitfaden SKI des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) eine gute Grundlage. Für die Zuweisung der anrechenbaren Kosten sind die vorliegende Wegleitung zur Kostenrechnung (KoRe) sowie subsidiär das Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz (KRSV) des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen zu beachten. Die Gliederung und Beispiele in der ElCom-Mitteilung «Anrechenbarkeit Kosten Cybersicherheit» vom 28. September 2022 (abrufbar unter Mitteilungen) sollen dabei helfen diese Kosten sachgerecht zu erfassen. Generell sollten Kosten für den Schutz der OT[1] unter den Positionen 200 und 500und die Kosten für den Schutz der IT[2] unter der Position 600 der KoRe angegeben werden. Bei der Abschreibungsdauer für Hard- und Software gilt Tabelle 1 des KRSV. Die ElCom behält sich vor, im Rahmen ihrer Aufsicht die effiziente Umsetzung der Schutzmassnahmen und Kosten zu überprüfen. Die Finanzbuchhaltung sollte daher so ausgelegt werden, dass die Kosten für Massnahmen zum Schutz von Cybervorfällen möglichst einfach ausgewiesen werden könnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur Kosten für die Sparte Netz anrechenbar sind (Art. 15 StromVG i.V.m. Art. 10 StromVG). Kosten für den Schutz von IKT-Systemen anderer Sparten (z. B. Energie, Telekom, Gas, usw.) sind direkt oder mit einer sachgerechten Schlüsselung (Art. 7 Abs. 5 StromVV) zu trennen und den entsprechenden Sparten anzulasten (vgl. auch Kapitel 2, KRSV).
[1] Unter Operational Technology (OT) werden Technologien, welche direkt für die Bereitstellung oder Lieferung von Elektrizität notwendig sind (z. B. SCADA, PIA, Remote Access auf Installationen in Unterwerken, Rundsteuerung, Energiedatenmanagement (EDM), Smart Meter) verstanden.
[2] Unter Information Technology (IT) werden Technologien zur Datenverarbeitung, welche nicht direkt mit der Bereitstellung von Elektrizität zu tun haben (z. B. Kundendatenmanagement, Personaldatenmanagement, Büroanwendungen) verstanden.
3.2.10 Ausweis Kosten für Netzbetrieb (Position 200.1)
In dieser Position sind alle Kosten subsummiert, welche für den Betrieb einer effizienten und sicheren Netzinfrastruktur nötig sind. Dazu gehören namentlich die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Netze (Personal, Material, Fremdleistungen etc.) aber auch Aktivitäten wie Netzplanung, Führen des Geografischen Informationssystem GIS bzw. Nachführung des Leitungskatasters, Arbeiten im Zusammenhang mit dem Asset Management, Netzkontrolle oder etwa Pikettdienst. Ebenfalls unter diese Position fallen Kosten für Systemdienstleistungen im Verteilnetz und Fahrplanabweichungen. Im Weiteren fallen hierunter Kosten für die Betriebshaftpflichtversicherung, Kosten für die Erstellung von Dokumentationen und Prozessen, Kosten für Qualitätsmanagement, für Schulungen des Personals oder für Arbeitssicherheit.
3.2.11 Ausweis Kosten für Instandhaltung (Positionen 200.2)
Zu den Kosten für Instandhaltung gehören namentlich die Kosten für den Unterhalt von Anlagen wie Ersatz oder Teilersatz von Kleinteilen, Korrosionsschutz etc. Unter diese Position zur rechnen sind auch die Aktivitäten, welche nicht im regulatorischen Anlagevermögen aufgenommen werden dürfen wie Kosten für Abbruch oder für Provisorien sowie generelle Unterhaltskosten (vgl. 2.2.3 Kosten für Abbruch, Rückbau oder Provisorien sowie 2.2.5 Unterhaltskosten und Ersatzinvestitionen).
Die Leistungen für die Material- und Dienstleistungsbeschaffungen (Identifizierung des Bedarfs an Material und der Dienstleistungen sowie von potentiellen Anbietern, Marktanalyse, Selektion der Anbieter und Vertragsverhandlungen, Ausführung der Kaufaufträge) und das Lager (Kosten für die Materiallieferung oder Vorratshaltung, Qualitätskontrollen am vorrätigen Material, Wertverluste des Lagermaterials) für Unterhalt oder im Rahmen der Planungsschritte beim Bau einer Anlage (vgl. 2.1.3) können ebenfalls hier deklariert werden.
Die Positionen 200.1a «Netzbetrieb» und 200.2 «Instandhaltung» sind getrennt auszuweisen. Falls die Ausweisung nicht getrennt erfolgt, ist in den Bemerkungen dazu anzubringen.
3.2.12 Kosten für OSTRAL (Position 200.1b)
Sollte es zu einer Strommangellage kommen, kann die Wirtschaftliche Landesversorgung (WL) dem Bundesrat Bewirtschaftungsmassnahmen vorschlagen. Die WL hat den Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) mit den notwendigen Vorbereitungen im Hinblick auf die Durchführung von Massnahmen der WL betraut. Der VSE hat dazu die Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (OSTRAL) geschaffen. Unter dieser Position sollen Kosten erfasst werden, welche aufgrund von Anweisungen der OSTRAL zur Vorbereitung und zum Vollzug von Bewirtschaftungsmassnahen der WL anfallen (Verordnung über die Vollzugsorganisation der wirtschaftlichen Landesversorgung im Bereich der Elektrizitätswirtschaft (VOEW), SR 531.35, Art. 4 Abs. 2). Gemäss Artikel 4 Absatz 3 aVOEW (Fassung vom 1. Juni 2022) ist die ElCom für die Aufsicht dieser Kosten zuständig.
Ab den Tarifen 2025 gelten die Kosten, die den Netzbetreibern, Erzeugern und Speicherbetreibern unmittelbar durch Massnahmen entstehen, die nach dem Landesversorgungsgesetz zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung notwendig sind, als anrechenbare Betriebskosten des Übertragungsnetzes (Art. 15a Abs. 1 Bst. b StromVG; Art. 4a Abs. 1 VOEW). Die angefallenen Kosten sind somit Swissgrid in Rechnung zu stellen.
3.2.13 Diverse anrechenbare Betriebskosten (Position 200.3)
Sollten wälzbare Kosten, gleich welcher Art, ausnahmsweise keiner Position zugeordnet werden können, können Sie diese unter Position 200.3 ausweisen.
3.2.14 Wirkverluste des eigenen Netzes (Position 200.4)
In dieser Position sind ausschliesslich die im eigenen Netz entstandenen Wirkverluste einzutragen (vgl. dazu auch 3.1.2 oben).
Gemäss Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a StromVV stellt die Swissgrid den Netzbetreibern und den direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Endverbrauchern die Kosten für den Ausgleich von Wirkverlusten und die Lieferung von Blindenergie, welche diese verursacht haben, individuell in Rechnung. Diese Kosten sind über die Position 300 auszuweisen (vgl. 3.2.15 unten).
3.2.15 Ausweis der Kosten der höheren Netzebenen (Position 300)
Die Kosten der höheren Netzebenen werden zunächst automatisch aus dem Tabellenblatt «Allgemeine Angaben» übernommen. Wenn in Ihre Kalkulation ein anderer Wert eingeflossen ist, als der dort errechnete, ersetzen Sie den automatisch generierten Eintrag bitte durch den tatsächlichen Wert.
Die Kosten sind netto anzugeben, d.h. abzüglich etwaiger Preisrabatte. In Zusammenhang mit «Pancaking» empfangene Ausgleichszahlungen sind ebenfalls abzuziehen.
Die Kosten sind in der Spalte derjenigen Netzebene einzutragen, an welcher Sie beim vorgelagerten Netzbetreiber angeschlossen sind. Ist Ihre eigene oberste Netzebene z.B. die NE3, sind die Kosten des vorgelagerten Netzes in die Spalte NE2 einzutragen. Anders im Fall von «Pancaking», hier wären die Kosten in Spalte NE3 zu erfassen.
3.2.16 Ausweis der Kosten der Systemdienstleistungen sowie Stromreserve (Position 400)
Systemdienstleistungen (SDL) sowie die Stromreserve sind die für den stabilen und sicheren Netzbetrieb notwendigen Dienste in der Elektrizitätsversorgung. Es handelt sich damit um Hilfsdienstleistungen, welche die Stromnetzbetreiber neben der Übertragung und Verteilung elektrischer Energie zusätzlich erbringen müssen.
Unter der Position 400 werden die von Swissgrid in Rechnung gestellten Kosten für die von Swissgrid erbrachten Systemdienstleistungen sowie die Kosten der Stromreserve erfasst. Kosten für Systemdienstleistungen im Verteilnetz sind unter Position 200.1 (vgl. 3.2.10 oben) einzutragen.
Bitte verwenden Sie ausschliesslich diese Position für die von der Swissgrid in Rechnung gestellten Kosten und geben Sie diese nicht etwa unter Verwendung der Netzebene 1 an.
3.2.17 Ausweis der Kosten für Mess-, Steuer- und Regelsysteme (Position 500)
3.2.17.1 Allgemeines
In der Kostenrechnung müssen alle für die Berechnung der anrechenbaren Kosten notwendigen Positionen separat ausgewiesen werden. Dazu gehören auch die Kosten für das Mess- und Informationswesen, für intelligente Messsysteme sowie die Kosten für intelligente Steuer- und Regelsysteme einschliesslich der Vergütungen (Art. 7 Abs. 3 Bst. f, fbis und m StromVV).
Gemäss Artikel 13a Buchstabe a StromVV sind alle Kapital- und Betriebskosten von Messsystemen nach der StromVV anrechenbar. Dies gilt für alle Messsysteme, die unter dem zeitlichen Geltungsbereich der neuen StromVV, d. h. ab 1.1.2018 in Betrieb genommen werden. Somit sind Kosten für Lastgangmessungen (die noch nicht aArt. 8a ff. StromVV entsprechen) als Netzkosten anrechenbar (Art. 31l Abs. 3 StromVV).
Mit Inkrafttreten der Strategie Stromnetze am 1. Juni 2019 wurde Artikel 31e Absatz 4 StromVV aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt sind somit auch die Kosten der vor dem 1. Januar 2018 eingesetzten Lastgangmessungen anrechenbar. Bereits seit dem 1. Januar 2018 als Netzkosten anrechenbar sind die ab diesem Zeitpunkt bei Produzenten installierten Messungen (Art. 15 Abs. 1 StromVG; aArt. 13a Bst. a StromVV).
Die Kosten aus einer risikobasierten und effizienten Umsetzung von Massnahmen zur Cybersicherheit sind anrechenbar Kosten für den Schutz der OT dürfen u.a. in den Positionen 510.4 und 520.4 angegeben werden (ausführlich dazu Ziff. 3.2.9.7).
3.2.17.2 Kosten für intelligente Messsysteme (Position 510)
Dienstleistungen im Rahmen des Mess- und Informationswesens können mit Zustimmung des Netzbetreibers auch von Dritten erbracht werden (vgl. aArt. 8 Abs. 2 StromVV).
Zur Umsetzung der oben genannten Bestimmungen (Art. 7 Abs. 3 Bst. f und fbis sowie aArt. 8 Abs. 2 StromVV) muss der VNB die Kosten – namentlich diejenigen für Messdienstleistungen – detailliert ausweisen.
Artikel 17a StromVG, der durch die aArtikel 8a und 8b StromVV präzisiert wird, legt den Mindeststandard bezüglich intelligenter Messsysteme fest. 80 Prozent der Messeinrichtungen in einem Netzgebiet müssen bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017, das heisst per 31. Dezember 2027, diesem Standard entsprechen (Art. 31e Abs. 1 StromVV).
Die Kosten der intelligenten Messsysteme, welche den in Artikel 17a StromVG in Verbindung mit den aArtikeln 8a und 8b StromVV festgelegten Standards entsprechen, sind unter der Position 510 «Kosten für intelligente Messsysteme» einzutragen. Die Kosten für Messsysteme, die gemäss Artikel 31l Absätze 1 und 2 StromVV den 80 Prozent zugeordnet werden können, werden ebenfalls der Position 510 «Kosten für intelligente Messsysteme» zugeteilt. Dies im Gegensatz zum KRSV-CH, welches diese Kosten der Position 520 «Kosten für übriges Mess- und Informationswesen» zuordnet (vgl. auch 2.2.8).
3.2.17.3 Kosten für übriges Mess- und Informationswesen (520)
Alle Messeinrichtungen, die nicht den in Artikel 17a StromVG in Verbindung mit aArtikel 8a und 8b StromVV festgelegten Standards entsprechen und nicht gemäss Artikel 31l Absätze 1 und 2 StromVV den 80 Prozent zugeordnet werden können, aber nach wie vor in Gebrauch sind, müssen unter der Position 520 «Kosten für übriges Messwesen und Informationswesen» eingetragen werden.
3.2.17.4 Kalkulatorische Abschreibungen für die Messsysteme beider Arten (Position 510.1 und 520.1)
Unter dieser Position sind die Abschreibungen der Messsysteme des regulatorischen Anlagevermögens zu erfassen. Eine doppelte Berücksichtigung der Kosten der Messsysteme einerseits im regulatorischen Anlagevermögen des Netzes und in den Abschreibungen unter Position 100.1 und andererseits in den Messkosten ist nicht zulässig. Anteilig verwendete Anlagen wie z. B. Energiedatenmanagementsysteme sind auch anteilig den Messkosten und dem Netz zuzuordnen. Die ElCom behält sich vor, Stichproben vorzunehmen.
Beispiele für Anlagen, welche ins regulatorische Anlagevermögen aufgenommen und folglich abgeschrieben und verzinst werden dürfen, sind: Zähler, allfällige Wandler, Prüfklemmen, Kommunikationseinheiten, mobile Datenerfassung, Zählerfernauslesung, etc.
3.2.17.5 Kalkulatorische Zinsen für die Messsysteme beider Arten (Position 510.2 und 520.2)
Unter dieser Position sind die kalkulatorischen Zinsen der Messsysteme des regulatorischen Anlagevermögens zu erfassen. Eine doppelte Berücksichtigung der Kosten der Messsysteme einerseits im regulatorischen Anlagevermögen des Netzes und in den Zinsen unter Position 100.2 und andererseits in den Messkosten ist nicht zulässig.
Da das Messwesen ebenfalls zu den Netzkosten und damit zum betriebsnotwendigen Vermögen des Netzes gehört, gilt für die Verzinsung derselbe WACC wie für die kalkulatorischen Zinsen des Netzes.
3.2.17.6 Kosten der Messdienstleistungen für die Messsysteme beider Arten (Position 510.3 und 520.3)
Es sind für die intelligenten Messsysteme folgende anteilige Kosten einzutragen (eigene oder Drittkosten):
- Betriebskosten Zählerfernauslesung (ZFA) und Datenübertragungskosten
- Betriebskosten Energiedatenmanagement (anteilige Kosten EDM-Netz) für Datenbereitstellung, Datenarchivierung und Datenlieferung
- Betriebskosten Energiedatenmanagement (anteilige Kosten EDM-Netz) für Wechselprozesse, Datenplausibilisierung und Ermittlung von Ersatzwerten
3.2.17.7 Betriebs- und Verwaltungskosten für die Messsysteme beider Arten (Position 510.4 und 520.4)
Hier werden Kosten eingetragen wie etwa:
- Zählerlogistik (Beschaffung, Lagerung, Installation, Eichung, periodische Zählerprüfung, Instandhaltung, Losverwaltung, etc.), Zähler- und Messstellenverwaltung (Stammdatenpflege)
- Betriebskosten für Ablesung und Datenübertragung (z.B. mobile Datenerfassung (MDE))
- Kommunikationskosten
- Anteilige Raum-, Informatik- und Fahrzeugkosten, etc.
3.2.17.8 Intelligente Steuer- und Regelsysteme (Position 530)
Stimmt ein Endverbraucher, ein Erzeuger oder ein Speicherbetreiber zu, dass bei ihm ein Steuer- und Regelsystem für den sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb (Flexibilität) zum Einsatz gelangt, vereinbart er mit dem Netzbetreiber insbesondere, wie der Einsatz des Systems vergütet wird (Art. 8c Abs. 1 Bst. c StromVV).
Diese Vergütung muss auf sachlichen Kriterien beruhen und darf nicht diskriminierend sein (Art. 8c Abs. 2, StromVV). Die Vergütungsansätze müssen veröffentlicht werden (Art. 8c Abs. 3 StromVV in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StromVG und aArt. 10 StromVV). In der Kostenrechnung müssen alle für die Berechnung der anrechenbaren Kosten notwendigen Positionen separat ausgewiesen werden, insbesondere die Kosten für intelligente Steuer- und Regelsysteme einschliesslich der Vergütungen (Art. 7 Abs. 3 Bst. m StromVV). Bei diesen Vergütungen handelt es sich um die Vergütung, die der Netzbetreiber dem Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber für dessen Flexibilität entrichtet (Art. 8c StromVV).
Um die vorgenannten Bestimmungen umzusetzen, muss der Verteilnetzbetreiber die Kosten, die von den Steuer- und Regelsystemen im Sinne von Artikel 8c StromVV erzeugt werden, detailliert ausweisen. Diese sind in der Kostenrechnung unter der Position 530 «Kosten für intelligente Steuer- und Regelsysteme» einzutragen. In der Position 530 müssen nebst allen Anlagen, die als intelligente Steuer- und Regelsysteme bezeichnet werden auch die klassischen Rundsteueranlagen eingetragen werden (vgl. Erläuterungen zur Teilrevision der StromVV vom November 2017, S. 10 ff.; Art. 31f StromVV).
Bietet der Netzbetreiber Endverbrauchern, Erzeugern oder Speicherbetreibern die Nutzung von deren Flexibilität mittels intelligenter Steuer- und Regelsysteme an, so muss er nicht nur die vorgesehene Vergütung in seinem Tarifblatt veröffentlichen (Art. 8c Abs. 3 StromVV in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StromVG und aArt. 10 StromVV), sondern auch die so ausgerichteten Beträge in der Kostenrechnung unter der Position 530.3 «Vergütungen an Endverbraucher oder Erzeuger» einzutragen.