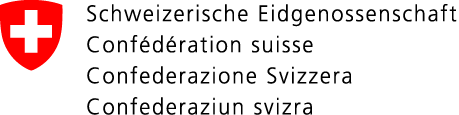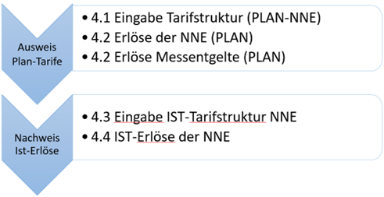5.2.1.4 Beschaffungskosten Energie: Grundversorgung / Endverbraucher, die von ihrem Netzzugang Gebrauch machen
Wie einführend erwähnt, sind für die Endverbraucher mit Grundversorgung und Endverbraucher, die von ihrem Netzzugang Gebrauch machen, getrennte Portfolien zu führen (Art. 6 Abs. 5bis Bst. b StromVG). Entsprechend sind auch die Kosten getrennt auszuweisen. Dabei gilt es die Vorgaben aus Artikel 6 Absatz 5 und 5bis StromVG sowie aus Artikel 4 Absatz 3 und 4 StromVV zu beachten.
Für die Berechnung der in der Grundversorgung anrechenbaren Energiekosten aus eigenen Kraftwerksanlagen und beteiligungsbedingten Bezügen ist auf die durchschnittlichen Gestehungskosten des gesamten Produktionsportfolios abzustellen (vgl. Art. 6 Abs. 5bis Bst. d Ziff. 1 StromVG). Eine Abweichung von dieser Logik ist bei einer Vorabzuweisung von Energie gemäss Marktprämienregelung (Art. 31 EnG) möglich. Eine preisliche Differenzierung der Eigenproduktion in durchschnittliche Gestehungskosten erneuerbare Energien sowie durchschnittliche Gestehungskosten nicht-erneuerbare Energien hingegen widerspricht den stromversorgungsrechtlichen Vorgaben.
In der Grundversorgung sind bestimmte Mindestmengen aus erneuerbarer Inlandproduktion abzusetzen. Die Mindestanteile beziehen sich auf das Tarifjahr (und nicht auf Quartale oder Monate) und werden in Artikel 4a StromVV näher konkretisiert:
Der Mindestanteil 1 betrifft die erweiterte Eigenproduktion (Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis StromVG) aus inländischen erneuerbaren Energien, welche zu mindestens 50 Prozent in der Grundversorgung abgesetzt werden muss. Solange mindestens 80 Prozent der in der Grundversorgung abgesetzten Elektrizität aus dieser erweiterten Eigenproduktion stammt, darf dieser Mindestanteil auch unterschritten werden (Art. 4a Abs. 1 StromVV).
Der Mindestanteil 2 bezieht sich auf den Grundversorgungsabsatz. Demnach müssen mindestens 20 Prozent der in der Grundversorgung abgesetzten Elektrizität aus erneuerbaren Energien aus Anlagen im Inland stammen. Ist zur Erreichung dieses Mindestanteils der Abschluss von Bezugsverträgen erforderlich, so müssen diese eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren haben (Art. 4a Abs. 2 StromVV).
Die beiden Mindestanteile sind verbindlich bis zum 31. August für das folgende Tarifjahr zu deklarieren (Art. 4a Abs. 3 StromVV). Auf Basis der eingegebenen Mengenangaben zur erweiterten Eigenproduktion, zu den Beschaffungsverträgen gemäss Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b StromVG sowie zum geplanten Grundversorgungsabsatz werden die entsprechenden Vergleichswerte zeitgleich berechnet (s. unterhalb Kostenaufstellung).
Nachfolgend einige Grundzüge und Erläuterungen zur Befüllung der konkreten Zeilen im Bereich Beschaffungskosten Energie:
Wenn Sie eingangs deklariert haben, dass Sie Ihren Kunden in der Grundversorgung Energie gemäss Artikel 31 EnG (Marktprämie) verrechnen, werden die entsprechenden Angaben automatisch aus dem Bereich «erweiterte Eigenproduktion Plan» übernommen.
Die Zuweisung der Produktion aus eigenen Anlagen und Beteiligungen hat insbesondere unter Berücksichtigung der Vorgaben zu den Mindestanteilen an Elektrizität aus erneuerbarer Inlandproduktion (vgl. unterhalb der Kostenaufstellung) zu erfolgen. Die ElCom hat am 4. März 2025 eine Mitteilung betreffend Mindestanteil der erweiterten Eigenproduktion aus inländischen erneuerbaren Energien in der Grundversorgung (Mindestanteil 1): Präzisierungen publiziert. Die darin ausgeführten Grundsätze sind ebenfalls zu beachten.
Der gesonderte Ausweis von inländisch erneuerbarer Energie ist für die Berechnung der Mindestanteile erforderlich. Kostenmässig sind auch für diese Teilmenge maximal die durchschnittlichen Gestehungskosten des gesamten Produktionsportfolios (vgl. oben) anrechenbar – ungeachtet der für die Stromproduktion verwendeten Primärenergie oder des Absatzkanals. Die entsprechenden Werte werden automatisch aus dem Bereich «erweiterte Eigenproduktion Plan» übernommen.
Die Energie aus der Abnahmepflicht (Art. 15 EnG) gehört ebenfalls zur erweiterten Eigenproduktion. Die in der Grundversorgung maximal anrechenbaren Kosten richten sich nach den Vorgaben aus Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e StromVV:
- Bei Abnahme mit HKN: primär die entsprechende Vergütung; maximal Gestehungskosten nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzüglich allfälliger Fördermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung (Vergütungssätze gem. Anhang EnFV; SR 730.03)
(Ist der HKN für Erneuerbare, ist diese Elektrizität für die Erfüllung der Mindestanteile relevant.)
- Ohne Abnahme HKN: primär die entsprechende Vergütung; maximal schweizweit harmonisierter Preis nach Art. 15 Abs. 1 EnG zum Zeitpunkt der Einspeisung oder die Minimalvergütung
(Diese Elektrizität gilt nicht als erneuerbar und ist für die Erfüllung der Mindestanteile nicht relevant.)
Netzbetreiber müssen einen Mindestanteil an Elektrizität aus erneuerbaren Energien aus Anlagen im Inland in der Grundversorgung absetzen (Mindestanteil 2). Reicht die erweiterte Eigenproduktion nicht aus, so sind die nötigen Mengen über mittel- und langfristige Bezugsverträge (Art. 6 Abs. 5 Bst. b StromVG) zu beschaffen. Zur Erfüllung des Mindestanteils 2 (20%) ist damit prioritär die erweiterte Eigenproduktion zu verwenden. Erst wenn diese nicht ausreicht, sind Bezugsverträge mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren abzuschliessen (Art. 4a Abs. 2 StromVV).[7] Die Beschaffung aus diesen Bezugsverträgen ist in der dafür vorgesehenen Zeile einzutragen. Diese Energiemenge ist relevant für die Berechnung des Mindestanteils 2 (s. unterhalb Kostenaufstellung).
Die restliche Elektrizitätsbeschaffung ist in der Rubrik «übrige Beschaffungen» auszuweisen. Die Mengen und Kosten der Ausgleichsenergie sind als Unterkategorie gesondert einzutragen. Neue Bezugsverträge sind mit der ganzen oder einem Teil der Elektrizitätsmenge, mit Wirkung für die gesamte Laufzeit dem jeweiligen Segment (Grundversorgung / Endverbraucher, die von ihrem Netzzugang Gebrauch machen) zuzuweisen (Art. 6 Abs. 5bis Bst. b StromVG). Bei am 1.1.2025 bereits laufenden Bezugsverträgen müssen Netzbetreiber mit Wirkung für die Restvertragslaufzeit entscheiden, ob und mit welcher Energiemenge diese Bezugsverträge der Grundversorgung zugewiesen werden (Art. 33c Abs. 2 StromVG und Weisung 2/2025 der ElCom).
Verteilnetzbetreiber haben vorrangig HKN zu verwenden, die aus ihrer erweiterten Eigenproduktion stammen (Art. 4 Abs. 3 Bst d StromVV). Diese Pflicht bezieht sich auf den ganzen Absatz in der Grundversorgung und geht damit über den Mindestanteil 1 hinaus. Benötigt ein Verteilnetzbetreiber für die Grundversorgung HKN, hat er damit prioritär die HKN aus seiner erweiterten Eigenproduktion zu verwenden. Dies gilt unabhängig davon, ob die in der Grundversorgung abgesetzte Energie aus der erweiterten Eigenproduktion oder aus Bezugsverträgen stammt. Beschaffungskosten für weitere HKN sind folgerichtig nur anrechenbar, soweit zur Erfüllung des Produktversprechens keine eigenen HKN aus der erweiterten Eigenproduktion vorliegen. Die Beschaffungskosten für Schweizer HKN aus Wasserkraft und Photovoltaik sind als Unterpositionen gesondert auszuweisen.
Neben den Beschaffungskosten für die Energie gelten auch die der Grundversorgung zuzuordnenden Verwaltungs- und Vertriebskosten als anrechenbare Kosten. Sie beinhalten alle Kosten, die unmittelbar mit dem Einkauf und dem Vertrieb der Energie in der Grundversorgung zusammenhängen (vgl. entsprechende Ausführungen zu Form. 5.1).
Die Berechnung des angemessenen Gewinns in der Grundversorgung Energie erfolgt nach den Vorgaben aus Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer 5 StromVV. Der angemessene Gewinn entspricht maximal den jährlichen kalkulatorischen Zinsen auf dem betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögen (Basis: anrechenbare Kosten nach den Ziffern 1–4) unter Berücksichtigung der Rechnungsperiodizität; es gilt der kalkulatorische Zinssatz nach Anhang 1 StromVV (WACC Netz). Die Weisung 3/2022 der ElCom betreffend «60-Franken-Regel» kommt ab dem Tarifjahr 2026 nicht mehr zur Anwendung.
Von den Kosten für Massnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben zur Effizienzsteigerung (Art. 4d StromVV) kann den Endverbrauchern mit Grundversorgung derjenige Anteil belastet werden, der ihrem Anteil am Referenzstromabsatz entspricht. Es dürfen nur Kosten angerechnet werden, die maximal marktüblichen Ansätzen entsprechen oder in einem transparenten, diskriminierungsfreien und marktorientierten Verfahren in Auftrag gegeben wurden (Art. 4d Abs. 3 StromVV). Bitte beachten Sie dabei unbedingt die folgenden wichtigen Grundsätze:
- Für die Berechnung des Referenzstromabsatzes, die Festlegung der Effizienzziele sowie für die Beurteilung der Anrechenbarkeit der umgesetzten Massnahmen an diese Ziele ist das BFE zuständig. Auf der Webseite des BFE finden sich zahlreiche Umsetzungshilfen.
- Die ElCom ist zuständig zur Umsetzung von Artikel 6 Abs. 5ter StromVG in Verbindung mit Artikel 4d StromVV. Sie finden Antworten auf gewisse Fragen in der Mitteilung «Fragen und Antworten zur Energiestrategie 2050 ab Mantelerlass» vom 4. März 2025 (abrufbar unter Mitteilungen).
- Kosten sind nur anrechenbar, wenn sie
- ab Januar 2025 angefallen sind. Früher angefallene Kosten sind nicht anrechenbar. Explizit zu erwähnen ist, dass diese Nichtanrechenbarkeit der Kosten auch für in den Jahren 2022–2024 umgesetzte Massnahmen gilt, welche gemäss Artikel 80b EnV zeitlich beschränkt an die Effizienzziele angerechnet werden dürfen.
- für Massnahmen anfallen, welche vom BFE genehmigt werden.
- Die Kosten für Effizienzmassnahmen sind in demjenigen Jahr anrechenbar (Ist-Kosten), für welches sie beim BFE angemeldet wurden. Das bedeutet, dass 2026 umgesetzte Massnahmen, welche 2027 beim BFE angemeldet werden, im Jahr 2027 anrechenbar sind.
- Einen zusätzlichen Gewinnanteil begründen diese Kosten nicht, entsprechend sind sie nicht Bestandteil des betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögens.
Gewissen Endverbrauchern dürfen keine Kosten für Massnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben zur Effizienzsteigerung angelastet werden (Art. 4d Abs. 2 StromVV): Dies sind Endverbraucherinnen und Endverbraucher, welche die Voraussetzungen nach Artikel 40 EnG einhalten und deren Elektrizitätskosten mindestens 20 Prozent der Bruttowertschöpfung ausmachen, sowie Kraftwerke und Speicher ohne Endverbrauch nach Artikel 14a Absatz 1 StromVG (Art. 51a Abs. 2 EnV). Für solche Endverbraucher ist somit ein Energietarif vorzusehen (kann auch als Abschlag auf dem normalen Tarif auf dem Tarifblatt angegeben werden), welcher keine Kosten für Effizienzmassnahmen enthält.
Zur Bestimmung der geplant tarifarisch geltend gemachten Kosten sind abschliessend die eintarifierten Deckungsdifferenzen auszuweisen.
[7] Im erläuternden Bericht wird von einem Wahlrecht des Verteilnetzbetreibers gesprochen (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien: Änderung der Stromversorgungsverordnung mit Inkrafttreten am 1. Januar 2025, Erläuternder Bericht vom 20. November 2024, S. 13). Diese Ausführungen widersprechen dem klaren Wortlaut von Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b StromVG und sind daher nicht von Relevanz.